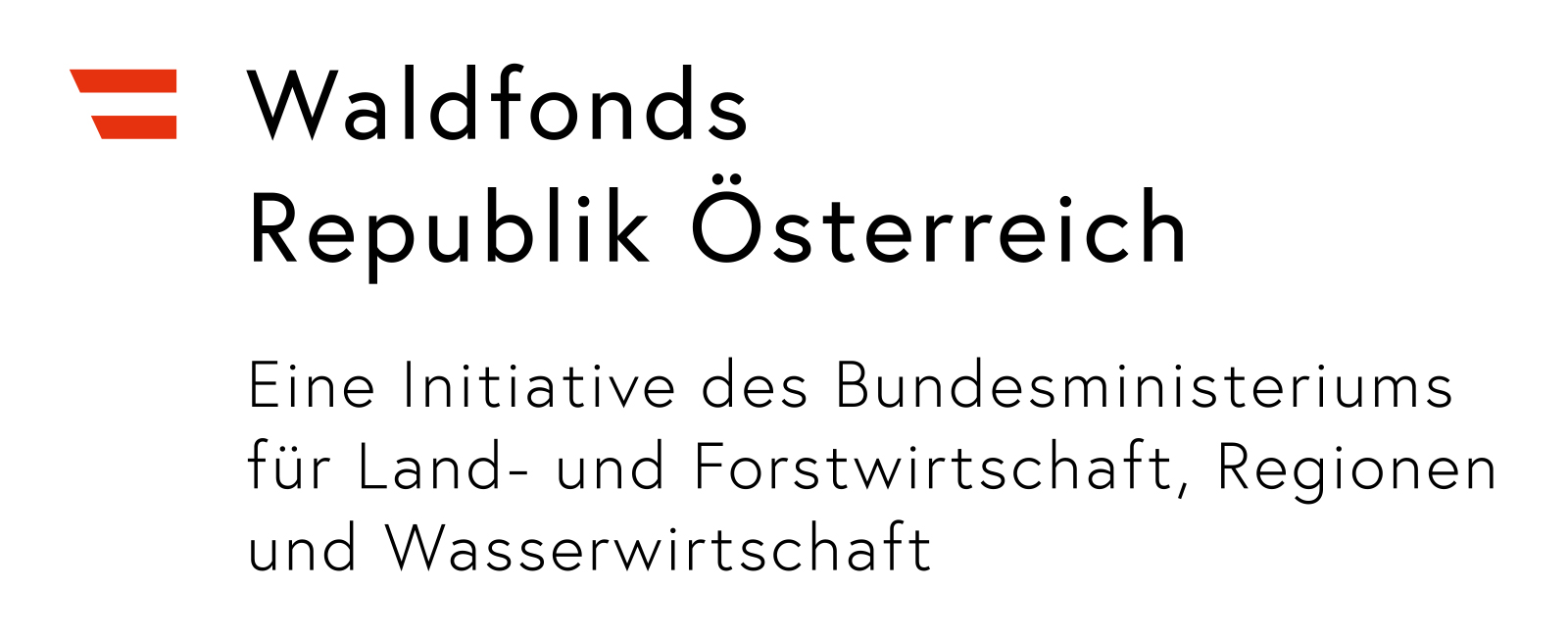Unter der Leitung der Holzforschung Austria und mit Beteiligung des IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie sowie zwölf Industriepartnern aus der gesamten Holzbranche untersuchte das Forschungsprojekt TimberLoop, wie rückgebaute Holzbauteile – etwa Balken, Brettschichtholz oder Fensterrahmen – unter der Berücksichtigung von technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten wiederverwendet bzw. -verwertet werden können.
Im Zuge des Projekts konnte unter anderen nachgewiesen werden, dass rückgebaute tragende Holzbauteile (z.B. Vollholz- und Brettschichtholzbalken) oftmals die Anforderungen für Frischholz in Bezug auf technische Parameter wie Biegefestigkeit und Elastizitätsmodul erfüllen. Stablamellen, welche aus gebrauchten Brettschichtholz produziert wurden, wiesen ebenfalls gute mechanische Eigenschaften auf. Ein Potenzial hinsichtlich einer hochwertigen Kreislaufführung dieser Materialien ist somit gegeben. Für eine tatsächliche Umsetzung ist aber neben den technischen Aspekten in Zukunft auch eine Anpassung des rechtlichen und normativen Rahmens nötig. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kreislaufführung im Bereich Mehrschichtparkett. Dabei wurde einerseits gezeigt, dass eine direkte Wiederwendung möglich ist, sofern eine schwimmende Verlegung des Fußbodens beim ursprünglichen Einbau eingesetzt wurde. Anderseits wurden Versuche zum Einsatz von Altholz in der Mittellage des Parketts durchgeführt. Hier konnte gezeigt werden, dass nach entsprechender Sortierung des Ausgangsmaterials die Produktion von Halbfabrikaten mit anschließendem Einsatz in der Parkett-Fertigung inkl. Einhaltung der Qualitätsanforderungen grundsätzlich möglich ist.
Ein besonderes Augenmerk wurde außerdem auf die Bestimmung und etwaige Entfernung von Kontaminationen (Biozide, Schwermetalle, Halogene etc.) in Altholz gelegt. Es konnte gezeigt werden, dass Schadstoffe oftmals nur oberflächennah vorhanden sind bzw. mit steigender Materialtiefe in ihrer Konzentration stark abnehmen. Übliche Verarbeitungsschritte im Rahmen der Kreislaufführung von Altholz (bspw. Schleifen und Hobeln) gehen somit mit einer Reduktion der Kontamination einher. Um in Zukunft überhaupt nicht von solchen Dekontaminationsprozessen abhängig zu sein, wurden im Zuge des Projektes auch die technischen Grundlagen für einen Verzicht auf chemischen Holzschutz für Produkte im bewitterten Außenbereich, ohne ständigen Erd- und/oder Wasserkontakt erforscht.
Begleitend zu den technischen Arbeiten wurden auch ökologisch und ökonomische Bewertungen der verschiedenen Kreislaufszenarien durchgeführt. Während die ökologischen Vorteile erwartungsgemäß in den meisten Fällen nachgewiesen werden konnten, zeigte sich für die ökonomische Situation ein differenziertes Bild. Der Einsatz von Altholz bietet grundsätzlich Potenzial für die Etablierung nachhaltiger Geschäftsmodelle und -praktiken, welche auch ökonomisch erfolgreich sind. Aktuell gibt es allerdings noch einige hemmende Faktoren wie bspw. die stark schwankende Materialverfügbarkeit und den unsicheren Rechtsrahmen. Mit den Arbeiten aus TimberLoop wurde ein erster Schritt gesetzt, um den Baustoff Holz langfristig im Kreislauf zu halten, für eine breite Implementierung sind aber noch weiterführende Aktivitäten sowohl im Bereich der Forschung als auch der industriellen Umsetzung von Nöten.
Fördergeber
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Waldfonds, einer Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert und im Rahmen des Programms Think.Wood der Österreichischen Holzinitiative durchgeführt.